Kaypro II
Der Kaypro II war das erste Modell des Unternehmens Kaypro und wurde 1982 veröffentlicht. Seine Entstehungsgeschichte ist eng mit der Vision seines Firmengründers Andrew Kay verbunden, der bereits über 30 Jahre Erfahrung in der Elektronik hatte und als Erfinder des digitalen Voltmeters bekannt wurde. Das Unternehmen, ursprünglich unter dem Namen Non Linear Systems, Inc. bekannt, hatte zuvor über 30 Jahre lang elektronische Testgeräte für die Luftfahrt produziert, und war somit nicht unerfahren in der Technologiebranche.
Kaypro war damals ein relativ neues Unternehmen auf dem Computer-Markt, doch das Modell "Kaypro II" war seiner Bezeichnung nach gerechtfertigt – die "2" wurde gewählt, um in gewisser Weise mit dem erfolgreichen Apple II zu konkurrieren und sich ein wenig des Ruhms des Marktführers zu sichern. Der Kaypro II war zu jener Zeit eher außerhalb des Mainstreams bekannt, aber das Unternehmen hatte einen bemerkenswerten Start, da es bald zu einem der bekanntesten Hersteller von tragbaren Computern wurde. Der Kaypro II war bekannt für seine Zähigkeit und Robustheit, was nicht zuletzt dem schützenden Aluminiumgehäuse zu verdanken war. Dieses Gehäuse verlieh dem Computer zum einen eine vergleichsweise geringe Dicke und trotzdem bemerkenswerte Stabilität. Derartige Eigenschaften machten den Computer besonders geeignet für Arbeitsumgebungen mit raueren Bedingungen. Insbesondere in der Rallye Paris-Dakar 1984 wurde das Modell von den teilnehmenden Ärzten als digitale Ausrüstung genutzt. Auch unter schwierigen Umständen blieb der Kaypro II unversehrt, was seine Bedeutung in anspruchsvollem Terrain unterstrich.
Im Inneren des Kaypro II verbarg sich ein Zilog Z80 Prozessor, der mit einer Taktfrequenz von 2,5 MHz arbeitete. Insgesamt standen dem Anwender 64 KByte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der Computer war mit einem 9“-Monochrom-Monitor ausgestattet, der 25 Zeilen mit je 80 Zeichen darstellte. Für farbliche Darstellungen oder detaillierte Grafiken war der Kaypro II zwar nicht geeignet, aber für den primären Einsatzbereich als Bürocomputer reichte diese Ausstattung völlig aus. Das Audiosystem bestand lediglich aus einem „Beeper“, weshalb der Kaypro II in Bezug auf die Klang- und Musikqualität keine Besonderheiten aufwies. Eines der Hauptmerkmale des Kaypro II war die Datenspeicherung, die über zwei 5,25“-Floppylaufwerke mit je 190 KByte Kapazität pro Diskette erfolgte. Hierbei war eine besondere Möglichkeit gegeben: Ein Laufwerk konnte als Systemlaufwerk für CP/M, das Betriebssystem des Geräts, verwendet werden, während das andere Laufwerk mit Programmen zur Ausführung bestückt war. Inmitten der damaligen Konkurrenz, wie etwa dem Osborne 1, zeichnete sich der Kaypro II durch seine solide Ausstattung und Ergonomie aus. Als Programmpaket waren Anwendungen wie „Perfect Writer“, „Perfect Calc“, „Perfect Filer“, „Perfect Speller“, S-Basic und Profitplan enthalten, die die unterschiedlichsten Bereiche der Arbeitswelt abdeckten, von Textverarbeitung über Tabellenkalkulation bis hin zu Business-Plan-Software. Der Kaypro II war insgesamt so beliebt, dass der Hersteller in seiner besten Verkaufszeit bis zu 10.000 Einheiten pro Monat absetzen konnte.
Der Computer fand nicht nur im Büroalltag begeisterte Nutzer, sondern auch prominente Persönlichkeiten wie Arthur C. Clarke, der Autor von „2001 – Odyssee im Weltraum“, nutzten diesen als Kommunikationsmittel. Clarke selbst wohnte zu dieser Zeit in Sri Lanka, während der Regisseur des zweiten Teils der filmischen Adaption in Los Angeles arbeitete. Mit der Hilfe des Kaypro II und eines Modems konnte Clarke fortwährend mit dem Regisseur in Kontakt bleiben, was seine Bedeutung im persönlichen Alltag des Erfolgsbuchautors hervorhob. Was den Preis des Kaypro II betrifft, so lag er zu seiner Markteinführung um die 2.000 US-Dollar, was unter Berücksichtigung der Inflation von heute etwa 5.700 bis 6.200 US-Dollar entspricht – dies variiert je nach jeweiligen Inflationskennzahlen und Berechnungen.
Das Modell hatte die Absicht, mobile Büroarbeit zu revolutionieren und präsentierte sich als geeigneter Ersatz für stationäre Büro-Computer, die hohe Kosten verursachten und wenig Flexibilität boten. Der Preis war ein Ausschlusskriterium für viele, doch der Wert, den die Kaypro-II-Besitzer aus der Hardware und den Software-Programmen ziehen konnten, war für viele Geschäftspioniere ein echtes Argument, diese zu kaufen.
Mit Blick auf die Anschlussmöglichkeiten war der Kaypro II für den damaligen Standard recht gut ausgestattet. Er besaß einen seriellen sowie einen parallelen Anschluss, die eine Vielzahl an Peripheriegeräten wie Drucker und externe Geräte unterstützten. Auch ein Anschluss für das Keyboard, ein Resetknopf und ein Drehregler zur Anpassung der Helligkeit fanden sich in der Gesamtstruktur des Gerätes, was zu seiner Benutzerfreundlichkeit maßgeblich beitrug. Zu den Peripheriegeräten, die zusätzlich für den Kaypro II angeboten wurden oder in Planung waren, gehörten unter anderem externe Festplattenlaufwerke und verschiedene Erweiterungen für die Leistungssteigerung der Maschine. Das erklärte Ziel war, den Computer zu einer zentralen Bürolösung für Unternehmen zu machen, die flexibler, mobiler und langfristig sogar kostengünstiger arbeiten wollten als mit herkömmlichen Computern der Zeit. Doch trotz des Erfolges und der Beliebtheit endete die Geschichte des Kaypro II mit einem allgemeinen Rückgang in den Verkaufszahlen.
Anfang der 1990er Jahre verlor Kaypro den Anschluss an die sich wandelnde Computerlandschaft, und das Unternehmen konnte mit seinen Computern keine Bedeutung mehr erlangen. Fazit der Geschichte: Der Kaypro II stellte einen wichtigen Baustein in den frühen Jahren tragbarer Informatik dar und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung dieser Computersparte bei. Es war ein robustes, funktionales Arbeitsgerät für Geschäftsreisende und professionelle Anwender. Dennoch konnte es nur einem begrenzten Kreis von Nutzern als langfristiger Arbeitsplatz dienen.


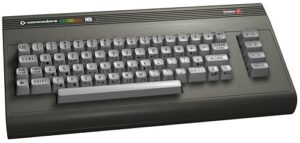

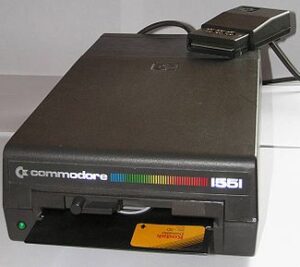

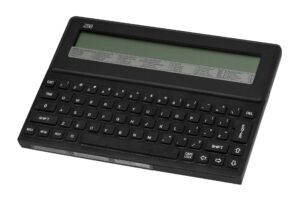


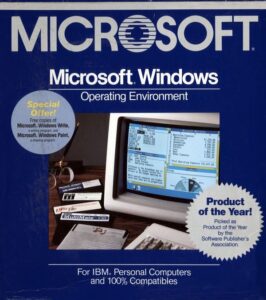





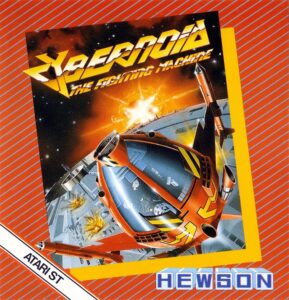






 Der Zilog Z80A ist ein 8-Bit-Mikroprozessor, der im Juli 1976 von Zilog auf den Markt gebracht wurde. Federico Faggin, der zuvor bei Intel an der Entwicklung des 8080 beteiligt war, gründete gemeinsam mit Ralph Ungermann das Unternehmen Zilog und entwickelte den Z80 als verbesserten und binär kompatiblen Nachfolger des Intel 8080. Der Z80A war eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Z80 und bot eine höhere Taktfrequenz von 4 MHz. Technisch zeichnete sich der Z80A durch eine erweiterte Befehlssatzarchitektur aus, die zusätzliche Instruktionen und Adressierungsmodi umfasste. Er verfügte über 8-Bit-Daten- und 16-Bit-Adressbusse, wodurch er bis zu 64 KB Speicher adressieren konnte. Ein bemerkenswertes Merkmal war die Integration von dynamischen RAM-Refresh-Schaltungen, die den Einsatz von dynamischem Speicher erleichterten. Die interne Architektur umfasste mehrere Registerpaare (BC, DE, HL) sowie Indexregister (IX, IY) und ermöglichte so flexible Datenmanipulationen.
Der Zilog Z80A ist ein 8-Bit-Mikroprozessor, der im Juli 1976 von Zilog auf den Markt gebracht wurde. Federico Faggin, der zuvor bei Intel an der Entwicklung des 8080 beteiligt war, gründete gemeinsam mit Ralph Ungermann das Unternehmen Zilog und entwickelte den Z80 als verbesserten und binär kompatiblen Nachfolger des Intel 8080. Der Z80A war eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Z80 und bot eine höhere Taktfrequenz von 4 MHz. Technisch zeichnete sich der Z80A durch eine erweiterte Befehlssatzarchitektur aus, die zusätzliche Instruktionen und Adressierungsmodi umfasste. Er verfügte über 8-Bit-Daten- und 16-Bit-Adressbusse, wodurch er bis zu 64 KB Speicher adressieren konnte. Ein bemerkenswertes Merkmal war die Integration von dynamischen RAM-Refresh-Schaltungen, die den Einsatz von dynamischem Speicher erleichterten. Die interne Architektur umfasste mehrere Registerpaare (BC, DE, HL) sowie Indexregister (IX, IY) und ermöglichte so flexible Datenmanipulationen.
 Der Iskra Delta 800 war ein 16-Bit-Computer, der 1984 vom jugoslawischen Unternehmen Iskra Delta entwickelt wurde. Er basierte auf der PDP-11/34-Architektur, der von 1970 bis 1990 hergestellt wurde und war vollständig kompatibel mit dieser. Die Entstehung des Iskra Delta 800 ist eng mit der Zusammenarbeit Jugoslawiens mit der US-amerikanischen Digital Equipment Corporation (DEC) in den frühen 1970er Jahren verknüpft. Diese Kooperation führte zur Entwicklung von Computern wie dem Iskradata 1680 und schließlich dem Iskra Delta 800.
Der Iskra Delta 800 war ein 16-Bit-Computer, der 1984 vom jugoslawischen Unternehmen Iskra Delta entwickelt wurde. Er basierte auf der PDP-11/34-Architektur, der von 1970 bis 1990 hergestellt wurde und war vollständig kompatibel mit dieser. Die Entstehung des Iskra Delta 800 ist eng mit der Zusammenarbeit Jugoslawiens mit der US-amerikanischen Digital Equipment Corporation (DEC) in den frühen 1970er Jahren verknüpft. Diese Kooperation führte zur Entwicklung von Computern wie dem Iskradata 1680 und schließlich dem Iskra Delta 800.