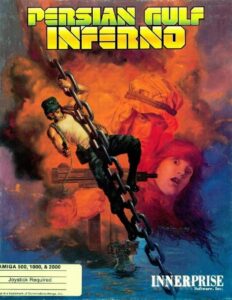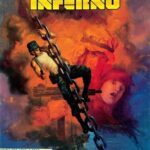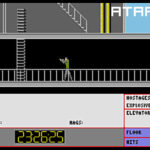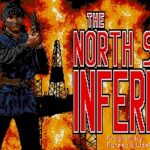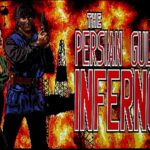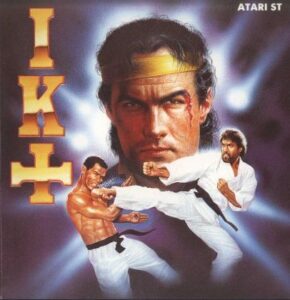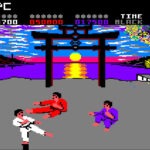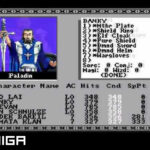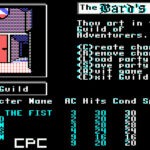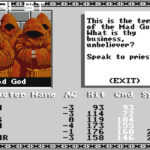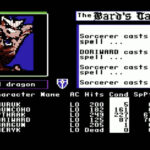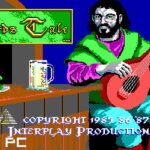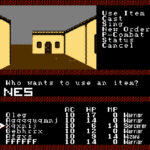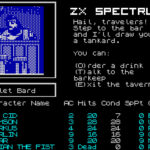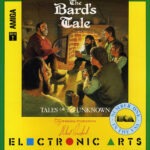Fujitsu FM-8

Fujitsu FM-8
Mit der Veröffentlichung des FM-8 stellte Fujitsu 1981 ihren zweiten Computer für den Massenmarkt vor. Vier Jahre zuvor kam der LKIT-8 Hobby-Computer auf den Markt, der allerdings noch als Selbstbaukit entwickelt worden war. Mit dem FM-8 hatte Fujitsu nun einen fertigen Heimcomputer entwickelt, der sofort betriebsbereit war. Zudem war der Computer der erste einer langen Reihe von Modellen, die mit dem Kürzel FM (Fujitsu Micro) begann und mit dem FM-Towns zu einem Traumcomputer der frühen 1990er wurde. Der FM-8 war zudem der erste Heimcomputer, der mit 64 KByte DRAM ausgestattet war. Diese Speichergröße war zuvor ausschließlich Mainframe-Rechnern vorbehalten.
Zu seiner Veröffentlichung war der FM-8 ein beeindruckendes Stück Technik, das bereits mit zwei Prozessoren ausgestattet war und auf 64 KByte RAM Zugriff hatte. Ebenso wie der Computer GRiD Compass besaß er einen Magnetblasenspeicher (Bubble Memory). Magnetblasenspeicher ist ein Datenspeicher, der auf einem dünnen Film basiert, der zahlreiche kleine Magnetbereiche besitzt (sogenannte Blasen), die jeweils 1 Bit speichern können. Positiv ist die Nichtflüchtigkeit, das heißt, dass selbst beim Ausschalten des Computers der Speicher nicht gelöscht wird. Im Grunde ist es ein Urahn heutiger SSD-Festplatten.
Wurde der Computer gestartet, erschien ein Boot-Menü, das das F-BASIC, DOS für Mini-Floppy-Disketten, den Bubble Memory und DOS für Standard-Floppy-Disketten enthielt. Der FM-8 beherrschte eine große Anzahl von Zeichendarstellungen, die es ihm ermöglichten, das Gerät weltweit ohne Modifikation anzubieten. Neben 69 alphanumerischen Zeichen beherrschte das System zusätzlich 63 Katakana-Zeichen und 62 grafische Symbole. Dies alles in der Zeichenauflösung von 8 × 8 Pixeln. Wurde die 16 × 16 Pixel-Auflösung gewählt, waren dazu noch 2.965 chinesische Zeichen sowie 453 nicht-chinesische Zeichen möglich.
Eines der auffälligsten Merkmale ist die Nutzung von zwei Prozessoren: Der Hauptprozessor ist ein Fujitsu 68A09, der mit 1,2 MHz getaktet ist, während der zweite Prozessor, ein Motorola 6809, mit 1 MHz arbeitet und für die Grafikdarstellung zuständig ist. Der Grafikprozessor besitzt ein eigenes Boot-ROM. Wird eine Grafikdarstellung benötigt, erhält der Grafikprozessor eine Anfrage vom Hauptprozessor und nutzt seine Software zur Erstellung des Bildes. Zur Kommunikation zwischen den Prozessoren existiert ein eigener Speicherbereich, der ausschließlich von den Prozessoren genutzt werden kann. Allerdings konnte die Nutzung zweier Prozessoren durchaus zum Flaschenhals werden, der die Leistung des Systems stark beeinträchtigte. Dies geschah immer dann, wenn der Hauptprozessor Befehle in den speziellen Speicherbereich schrieb. Dies führte dazu, dass der Grafikprozessor in dieser Zeit nicht auf die Daten zugreifen konnte und gestoppt wurde. Erst nach einem Neustart des Grafikprozessors konnte dieser mit seiner Arbeit beginnen. Das Problem hierbei war der äußerst kleine Speicherbereich für beide Prozessoren, der lediglich 128 Bytes umfasste. Für die Geschäftswelt war dieser Umstand nicht problematisch, für den Heimanwender, der zumeist spielte, war dieser Fehler schwerwiegender. Umgangen wurde das Problem durch einen fähigen Programmierer bei Fujitsu namens Yamauchi. Dieser hatte das Problem bereits bei der Entwicklung erkannt und zahlreiche Subroutinen in das BIOS integriert, die das System erheblich beschleunigten. Nachdem diese Subroutinen bekannt wurden, war der FM-8 ein beliebter Spielcomputer, der für seine nun gute Performance in Spielen bekannt wurde. Zusätzlich zu den beiden 6809-Prozessoren konnte der FM-8 mit Erweiterungskarten ausgestattet werden, die es ermöglichten, alternative Betriebssysteme wie CP/M-80 oder CP/M-86 auszuführen. Hierfür standen beispielsweise die MB22401 Z80-Karte oder die MB22404 8088-Karte zur Verfügung.
Der FM-8 wurde 1981 in Japan zu einem Preis von ¥218.000 angeboten. Inflationsbereinigt entspricht dies heute etwa ¥290.000, was ungefähr 1.690 Euro entspricht.








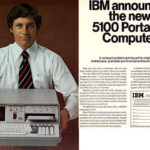




 Gestartet wurde das Projekt unter dem Entwicklungsnamen „Felix“ und stellte einen PDA dar, der MS-DOS kompatibel war (mit Ausnahme von wenigen Funktionen). Da der HP 200LX jedoch einen anderen Aufbau besaß als ein klassisches PDA, nannte man diese Klasse auch Palmtop Computer. Im Gegensatz zu den meisten PDAs der damaligen Zeit hatte dieses ein klappbares Gehäuse, das eine vollwertige Gummitastatur beinhaltete, die zudem um einen numerischen Block erweitert wurde. Insgesamt war das 200LX damit rund 25% kleiner, als ein Notebook jener Tage, besaß jedoch eine Lebensdauer von bis zu 40 Stunden. Die Energie lieferten dabei zwei herkömmliche AA-Batterien, die allerdings auch wiederaufladbar sein durften. Ein 12V-Netzteil konnte ebenfalls angeschlossen werden.
Gestartet wurde das Projekt unter dem Entwicklungsnamen „Felix“ und stellte einen PDA dar, der MS-DOS kompatibel war (mit Ausnahme von wenigen Funktionen). Da der HP 200LX jedoch einen anderen Aufbau besaß als ein klassisches PDA, nannte man diese Klasse auch Palmtop Computer. Im Gegensatz zu den meisten PDAs der damaligen Zeit hatte dieses ein klappbares Gehäuse, das eine vollwertige Gummitastatur beinhaltete, die zudem um einen numerischen Block erweitert wurde. Insgesamt war das 200LX damit rund 25% kleiner, als ein Notebook jener Tage, besaß jedoch eine Lebensdauer von bis zu 40 Stunden. Die Energie lieferten dabei zwei herkömmliche AA-Batterien, die allerdings auch wiederaufladbar sein durften. Ein 12V-Netzteil konnte ebenfalls angeschlossen werden.