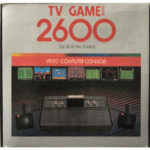Sega Mega Drive EU Mk1
Das Sega Mega Drive, bekannt als Sega Genesis in Nordamerika, wurde 1988 von Sega eingeführt und markierte einen bedeutenden Schritt im Konsolenkrieg der späten 1980er und frühen 1990er Jahre. Als dritte Heimkonsole von Sega und Nachfolger des Master Systems trat das Mega Drive gegen Nintendos NES und NECs PC Engine an, die beide technisch unterlegen waren. Diese Überlegenheit verschaffte Sega einen fast zweijährigen Vorsprung, wodurch das Mega Drive zum erfolgreichsten Videospielsystem des Unternehmens wurde.
Die Konzeption des Mega Drive basierte auf Segas System-16-Arcade-Hardware. Durch die Anpassung dieser Technologie für den Heimgebrauch konnte Sega eine Konsole entwickeln, die sowohl leistungsstark als auch entwicklerfreundlich war. Am 29. Oktober 1988 wurde das System in Japan zu einem Preis von 21.000 ¥ (inflationsbereinigt etwa 317 €) veröffentlicht. Der US-Markt sollte ursprünglich am 9. Januar 1989 in Zusammenarbeit mit Atari bedient werden. Da jedoch keine Einigung erzielt wurde, musste Sega den US-Start allein bewältigen und brachte die Konsole schließlich am 14. August 1989 unter dem Namen Sega Genesis auf den Markt. Der Namenswechsel war erforderlich, da Sega die Namensrechte für "Mega Drive" in den USA nicht besaß.
 Das Sega Mega Drive verfügte über eine Vielzahl von Anschlüssen, die es sowohl für Standard-Spieler als auch für fortgeschrittene Nutzer interessant machten. Auf der Vorderseite der Konsole befanden sich zwei 9-polige Controller-Ports, die mit den klassischen Sega-Controllern kompatibel waren. Diese Ports nutzten das gleiche DB-9-Format wie die Controller des Master Systems und des Atari 2600, wodurch auch einige ältere Peripheriegeräte verwendet werden konnten. Auf der Rückseite der Konsole bot das Mega Drive mehrere Anschlüsse für Video- und Audioausgabe. Das Standard-Modell verfügte über einen RF-Ausgang für den Anschluss an ältere Fernseher, der das Signal auf einen bestimmten Fernsehkanal übertrug. Für eine bessere Bildqualität wurde zudem ein Multi-AV-Ausgang bereitgestellt, der sowohl Composite- als auch RGB-Signale über ein entsprechendes SCART-Kabel ausgeben konnte. Dieses Feature war insbesondere in Europa von Bedeutung, da SCART-fähige Fernseher eine deutlich schärfere Bilddarstellung ermöglichten. Für die Audioausgabe besaß die Konsole eine separate Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler an der Vorderseite, was für viele Nutzer ein willkommenes Feature war, da es eine direktere, rauschfreie Klangwiedergabe ermöglichte.
Das Sega Mega Drive verfügte über eine Vielzahl von Anschlüssen, die es sowohl für Standard-Spieler als auch für fortgeschrittene Nutzer interessant machten. Auf der Vorderseite der Konsole befanden sich zwei 9-polige Controller-Ports, die mit den klassischen Sega-Controllern kompatibel waren. Diese Ports nutzten das gleiche DB-9-Format wie die Controller des Master Systems und des Atari 2600, wodurch auch einige ältere Peripheriegeräte verwendet werden konnten. Auf der Rückseite der Konsole bot das Mega Drive mehrere Anschlüsse für Video- und Audioausgabe. Das Standard-Modell verfügte über einen RF-Ausgang für den Anschluss an ältere Fernseher, der das Signal auf einen bestimmten Fernsehkanal übertrug. Für eine bessere Bildqualität wurde zudem ein Multi-AV-Ausgang bereitgestellt, der sowohl Composite- als auch RGB-Signale über ein entsprechendes SCART-Kabel ausgeben konnte. Dieses Feature war insbesondere in Europa von Bedeutung, da SCART-fähige Fernseher eine deutlich schärfere Bilddarstellung ermöglichten. Für die Audioausgabe besaß die Konsole eine separate Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler an der Vorderseite, was für viele Nutzer ein willkommenes Feature war, da es eine direktere, rauschfreie Klangwiedergabe ermöglichte.
 Ein besonders markanter Anschluss war der Erweiterungsport an der rechten Seite der Konsole. Dieser Anschluss diente dazu, verschiedene Zusatzgeräte anzuschließen, darunter das Mega-CD (Sega CD in den USA), eine CD-Erweiterung, die die technischen Möglichkeiten des Mega Drive erheblich erweiterte. Das Mega-CD bot eine größere Speicherkapazität für Spiele, bessere Audioqualität und die Möglichkeit, animierte Zwischensequenzen zu verwenden. Später wurde dieser Erweiterungsport auch für das 32X-Modul genutzt, das dem Mega Drive eine begrenzte 32-Bit-Funktionalität verlieh. Allerdings war das 32X kommerziell nicht erfolgreich, was größtenteils auf die Verwirrung der Kunden über die zahlreichen Hardware-Upgrades zurückzuführen war.
Ein besonders markanter Anschluss war der Erweiterungsport an der rechten Seite der Konsole. Dieser Anschluss diente dazu, verschiedene Zusatzgeräte anzuschließen, darunter das Mega-CD (Sega CD in den USA), eine CD-Erweiterung, die die technischen Möglichkeiten des Mega Drive erheblich erweiterte. Das Mega-CD bot eine größere Speicherkapazität für Spiele, bessere Audioqualität und die Möglichkeit, animierte Zwischensequenzen zu verwenden. Später wurde dieser Erweiterungsport auch für das 32X-Modul genutzt, das dem Mega Drive eine begrenzte 32-Bit-Funktionalität verlieh. Allerdings war das 32X kommerziell nicht erfolgreich, was größtenteils auf die Verwirrung der Kunden über die zahlreichen Hardware-Upgrades zurückzuführen war.
Zusätzlich existierte ein Anschluss für einen Sega-Multi-Tap-Adapter, der die Anzahl der gleichzeitig verwendbaren Controller auf bis zu vier erhöhte. Dies wurde vor allem von Multiplayer-Spielen wie "Mega Bomberman" oder "Micro Machines 2" genutzt. Auch ein Modem-Anschluss war geplant, um frühe Online-Dienste wie das Sega Meganet in Japan zu unterstützen, doch dieser Dienst blieb auf wenige Spiele beschränkt und wurde nie außerhalb Japans eingeführt.
In Brasilien hingegen erlebte Sega einen unerwarteten Erfolg. Tec Toy übernahm den Vertrieb der Konsole und setzte auf lokal entwickelte Spiele, die speziell für den brasilianischen Markt konzipiert wurden. 2007 erschien dort eine tragbare Variante des Mega Drive mit 20 vorinstallierten Spielen. Auch in Indien wurde eine landeseigene Version unter dem Namen Super Aladdin Boy veröffentlicht, die sich ebenfalls gut verkaufte.
In Japan konnte sich das Mega Drive trotz des frühen Starts nicht gegen das später erschienene Super Nintendo (SNES) oder die PC Engine durchsetzen. In Europa hingegen hatte die Konsole einen erfolgreichen Start und wurde erst später vom Super Nintendo übertroffen. Ein Grund dafür waren die erfolglosen Zusatzgeräte wie das Mega-CD und das 32X, die Segas Ruf beeinträchtigten. Im ersten Jahr wurden in Japan lediglich 400.000 Konsolen verkauft, obwohl die Technik der Konkurrenz überlegen war. Sega versuchte, den Verkauf durch Peripheriegeräte wie das Home Banking System oder einen Anrufbeantworter zu steigern, doch diese bizarren Ideen konnten die Platzierung nicht verbessern: Das Mega Drive blieb hinter dem NES und der PC Engine zurück.
Um die Qualität der Konsole zu demonstrieren, produzierte Sega eigene Software und lizenzierte die Namen zahlreicher Sportgrößen wie Arnold Palmer, Joe Montana und Pat Riley für verschiedene Spiele. Auch Michael Jackson wurde für das Spiel "Moonwalker" gewonnen, das sowohl als Arcade-Version als auch für Sega-Konsolen erschien.
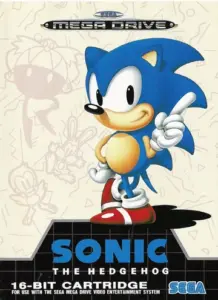 Im Sommer 1990 wechselte der Vorsitz von Sega of America zu Tom Kalinske, der vier entscheidende Veränderungen einführte: eine drastische Preissenkung der Konsole, die Gründung einer amerikanischen Softwareabteilung, aggressive Marketingkampagnen und den Austausch des mitgelieferten Spiels. Statt "Altered Beast" wurde "Sonic the Hedgehog" zum neuen Aushängeschild. Kalinske setzte auf die Neuentwicklung von Sonic, die seit April 1990 in Arbeit war und das neue Maskottchen des Unternehmens darstellte. Sonic wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele des Unternehmens und steigerte den Umsatz enorm. Etliche Computerspielmagazine lobten das Spiel als bestes Plattformspiel aller Zeiten. Personen, die auf den Nachfolger des NES warteten, konnten überzeugt werden, stattdessen ein Mega Drive zu kaufen. Sega konnte nun den zweiten Platz in Amerika übernehmen und drängte die PC Engine auf den absteigenden Ast. 1992 besaß Sega 55 % des nordamerikanischen Marktes, während Nintendo mit dem Super NES lediglich 45 % verbuchen konnte. Zudem konnte Sega mit einem günstigeren Verkaufspreis punkten und verfügte auch über eine zehnmal größere Anzahl an Spielen. Sega war bei Jugendlichen und älteren Spielern deutlich beliebter; dank der Marketingkampagne des Unternehmens kam es sogar vor, dass Besitzer eines Super NES sich schämten zuzugeben, dass sie eine Konsole von Nintendo besaßen.
Im Sommer 1990 wechselte der Vorsitz von Sega of America zu Tom Kalinske, der vier entscheidende Veränderungen einführte: eine drastische Preissenkung der Konsole, die Gründung einer amerikanischen Softwareabteilung, aggressive Marketingkampagnen und den Austausch des mitgelieferten Spiels. Statt "Altered Beast" wurde "Sonic the Hedgehog" zum neuen Aushängeschild. Kalinske setzte auf die Neuentwicklung von Sonic, die seit April 1990 in Arbeit war und das neue Maskottchen des Unternehmens darstellte. Sonic wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele des Unternehmens und steigerte den Umsatz enorm. Etliche Computerspielmagazine lobten das Spiel als bestes Plattformspiel aller Zeiten. Personen, die auf den Nachfolger des NES warteten, konnten überzeugt werden, stattdessen ein Mega Drive zu kaufen. Sega konnte nun den zweiten Platz in Amerika übernehmen und drängte die PC Engine auf den absteigenden Ast. 1992 besaß Sega 55 % des nordamerikanischen Marktes, während Nintendo mit dem Super NES lediglich 45 % verbuchen konnte. Zudem konnte Sega mit einem günstigeren Verkaufspreis punkten und verfügte auch über eine zehnmal größere Anzahl an Spielen. Sega war bei Jugendlichen und älteren Spielern deutlich beliebter; dank der Marketingkampagne des Unternehmens kam es sogar vor, dass Besitzer eines Super NES sich schämten zuzugeben, dass sie eine Konsole von Nintendo besaßen.
Bis zum Ende des Jahres 1993 konnte Sega den Konkurrenten Nintendo deutlich auf Abstand halten, allerdings veränderte sich der Markt deutlich. Besonders die einflussreichen amerikanischen Medien begannen, ein Auge auf Spiele zu lenken, die für ein älteres Publikum gedacht waren. "Night Trap" hieß das Spiel, das den Stein ins Rollen brachte. In einer Anhörung vor dem Kongressausschuss wurde dieses Spiel, neben "Mortal Kombat", "Lethal Enforcers" und "Doom", als Beispiel für die Notwendigkeit einer Alterskontrolle herangezogen. Zahlreiche Vertriebe, wie Toys 'R' Us, nahmen diese Spiele aus dem Sortiment, als über die Gewalt in Computerspielen weiter debattiert wurde. Dies war ein schwerer Schlag für Sega. Nintendo gelang es dagegen, zahlreiche Stellen zu verharmlosen, indem sie Blut durch Schweiß austauschten (ersichtlich bei "Mortal Kombat"). Darüber hinaus galt Nintendo schon immer als familientauglicher, aufgrund der kindgerechteren Spielfiguren. Nintendo besaß zudem eine hauseigene Qualitätskontrolle, die schon zuvor etliche Spiele unterband.
Sega selbst entwickelte eine Kontrolle, die sie Videogame Rating Council (VRC) nannte und für alle hauseigenen Systeme verantwortlich war. Auch hier wurde das Spiel "Mortal Kombat" zensiert und ging weiter als bei Nintendo.
 Der Exelvision Exeltel war ein französischer Heimcomputer und Kommunikationssystem, das Mitte der 1980er Jahre entwickelt wurde. Er basierte auf der Technologie des vorherigen Exelvision EXL 100, wurde jedoch um eine Vielzahl von Funktionen erweitert, insbesondere im Bereich der Telekommunikation. Die Entwicklung des Exeltel begann als ambitioniertes Projekt, das den Heimcomputer mit der aufkommenden Welt der digitalen Kommunikation verbinden sollte. Ursprünglich als ein leistungsfähiges Terminal für Teletext und Online-Dienste konzipiert, wurde er schließlich als ein Hybrid aus Heimcomputer und Kommunikationsgerät vermarktet.
Der Exelvision Exeltel war ein französischer Heimcomputer und Kommunikationssystem, das Mitte der 1980er Jahre entwickelt wurde. Er basierte auf der Technologie des vorherigen Exelvision EXL 100, wurde jedoch um eine Vielzahl von Funktionen erweitert, insbesondere im Bereich der Telekommunikation. Die Entwicklung des Exeltel begann als ambitioniertes Projekt, das den Heimcomputer mit der aufkommenden Welt der digitalen Kommunikation verbinden sollte. Ursprünglich als ein leistungsfähiges Terminal für Teletext und Online-Dienste konzipiert, wurde er schließlich als ein Hybrid aus Heimcomputer und Kommunikationsgerät vermarktet.
 Die Welt musste zwei lange Jahre warten, seit der ersten Bekanntgabe des Systems bis zum öffentlichen Verkauf, und die Namensfindung war nicht weniger verwirrend, hieß er doch erst Elan 64, dann Flan und letztlich Enterprise. Doch Computerbegeisterte warteten sehnsüchtig auf dieses System, sollte es doch Fähigkeiten besitzen, die jeglichen Computern dieser Zeit fehlten. Allein die Grafik- und Soundfähigkeiten sollten weit über jenen aller anderen Computer dieser Zeit liegen. Der Enterprise besaß eigens dafür zwei Customchips, namens Nick und Dave. Nick war für die Grafikausgabe zuständig und erlaubte flexible Bildschirmmodi mit hoher Farbanzahl und programmierbaren Text- und Grafikauflösungen. Dave hingegen steuerte den Sound und ermöglichte Mehrkanal-Audioausgabe mit komplexen Effekten, die bei Konkurrenzsystemen nur schwer oder gar nicht realisierbar waren.
Die Welt musste zwei lange Jahre warten, seit der ersten Bekanntgabe des Systems bis zum öffentlichen Verkauf, und die Namensfindung war nicht weniger verwirrend, hieß er doch erst Elan 64, dann Flan und letztlich Enterprise. Doch Computerbegeisterte warteten sehnsüchtig auf dieses System, sollte es doch Fähigkeiten besitzen, die jeglichen Computern dieser Zeit fehlten. Allein die Grafik- und Soundfähigkeiten sollten weit über jenen aller anderen Computer dieser Zeit liegen. Der Enterprise besaß eigens dafür zwei Customchips, namens Nick und Dave. Nick war für die Grafikausgabe zuständig und erlaubte flexible Bildschirmmodi mit hoher Farbanzahl und programmierbaren Text- und Grafikauflösungen. Dave hingegen steuerte den Sound und ermöglichte Mehrkanal-Audioausgabe mit komplexen Effekten, die bei Konkurrenzsystemen nur schwer oder gar nicht realisierbar waren.
 Das Sega Mega Drive verfügte über eine Vielzahl von Anschlüssen, die es sowohl für Standard-Spieler als auch für fortgeschrittene Nutzer interessant machten. Auf der Vorderseite der Konsole befanden sich zwei 9-polige Controller-Ports, die mit den klassischen Sega-Controllern kompatibel waren. Diese Ports nutzten das gleiche DB-9-Format wie die Controller des Master Systems und des Atari 2600, wodurch auch einige ältere Peripheriegeräte verwendet werden konnten. Auf der Rückseite der Konsole bot das Mega Drive mehrere Anschlüsse für Video- und Audioausgabe. Das Standard-Modell verfügte über einen RF-Ausgang für den Anschluss an ältere Fernseher, der das Signal auf einen bestimmten Fernsehkanal übertrug. Für eine bessere Bildqualität wurde zudem ein Multi-AV-Ausgang bereitgestellt, der sowohl Composite- als auch RGB-Signale über ein entsprechendes SCART-Kabel ausgeben konnte. Dieses Feature war insbesondere in Europa von Bedeutung, da SCART-fähige Fernseher eine deutlich schärfere Bilddarstellung ermöglichten. Für die Audioausgabe besaß die Konsole eine separate Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler an der Vorderseite, was für viele Nutzer ein willkommenes Feature war, da es eine direktere, rauschfreie Klangwiedergabe ermöglichte.
Das Sega Mega Drive verfügte über eine Vielzahl von Anschlüssen, die es sowohl für Standard-Spieler als auch für fortgeschrittene Nutzer interessant machten. Auf der Vorderseite der Konsole befanden sich zwei 9-polige Controller-Ports, die mit den klassischen Sega-Controllern kompatibel waren. Diese Ports nutzten das gleiche DB-9-Format wie die Controller des Master Systems und des Atari 2600, wodurch auch einige ältere Peripheriegeräte verwendet werden konnten. Auf der Rückseite der Konsole bot das Mega Drive mehrere Anschlüsse für Video- und Audioausgabe. Das Standard-Modell verfügte über einen RF-Ausgang für den Anschluss an ältere Fernseher, der das Signal auf einen bestimmten Fernsehkanal übertrug. Für eine bessere Bildqualität wurde zudem ein Multi-AV-Ausgang bereitgestellt, der sowohl Composite- als auch RGB-Signale über ein entsprechendes SCART-Kabel ausgeben konnte. Dieses Feature war insbesondere in Europa von Bedeutung, da SCART-fähige Fernseher eine deutlich schärfere Bilddarstellung ermöglichten. Für die Audioausgabe besaß die Konsole eine separate Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler an der Vorderseite, was für viele Nutzer ein willkommenes Feature war, da es eine direktere, rauschfreie Klangwiedergabe ermöglichte. Ein besonders markanter Anschluss war der Erweiterungsport an der rechten Seite der Konsole. Dieser Anschluss diente dazu, verschiedene Zusatzgeräte anzuschließen, darunter das Mega-CD (Sega CD in den USA), eine CD-Erweiterung, die die technischen Möglichkeiten des Mega Drive erheblich erweiterte. Das Mega-CD bot eine größere Speicherkapazität für Spiele, bessere Audioqualität und die Möglichkeit, animierte Zwischensequenzen zu verwenden. Später wurde dieser Erweiterungsport auch für das 32X-Modul genutzt, das dem Mega Drive eine begrenzte 32-Bit-Funktionalität verlieh. Allerdings war das 32X kommerziell nicht erfolgreich, was größtenteils auf die Verwirrung der Kunden über die zahlreichen Hardware-Upgrades zurückzuführen war.
Ein besonders markanter Anschluss war der Erweiterungsport an der rechten Seite der Konsole. Dieser Anschluss diente dazu, verschiedene Zusatzgeräte anzuschließen, darunter das Mega-CD (Sega CD in den USA), eine CD-Erweiterung, die die technischen Möglichkeiten des Mega Drive erheblich erweiterte. Das Mega-CD bot eine größere Speicherkapazität für Spiele, bessere Audioqualität und die Möglichkeit, animierte Zwischensequenzen zu verwenden. Später wurde dieser Erweiterungsport auch für das 32X-Modul genutzt, das dem Mega Drive eine begrenzte 32-Bit-Funktionalität verlieh. Allerdings war das 32X kommerziell nicht erfolgreich, was größtenteils auf die Verwirrung der Kunden über die zahlreichen Hardware-Upgrades zurückzuführen war.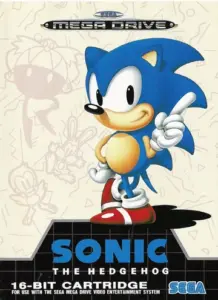 Im Sommer 1990 wechselte der Vorsitz von Sega of America zu Tom Kalinske, der vier entscheidende Veränderungen einführte: eine drastische Preissenkung der Konsole, die Gründung einer amerikanischen Softwareabteilung, aggressive Marketingkampagnen und den Austausch des mitgelieferten Spiels. Statt "Altered Beast" wurde "Sonic the Hedgehog" zum neuen Aushängeschild. Kalinske setzte auf die Neuentwicklung von Sonic, die seit April 1990 in Arbeit war und das neue Maskottchen des Unternehmens darstellte. Sonic wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele des Unternehmens und steigerte den Umsatz enorm. Etliche Computerspielmagazine lobten das Spiel als bestes Plattformspiel aller Zeiten. Personen, die auf den Nachfolger des NES warteten, konnten überzeugt werden, stattdessen ein Mega Drive zu kaufen. Sega konnte nun den zweiten Platz in Amerika übernehmen und drängte die PC Engine auf den absteigenden Ast. 1992 besaß Sega 55 % des nordamerikanischen Marktes, während Nintendo mit dem Super NES lediglich 45 % verbuchen konnte. Zudem konnte Sega mit einem günstigeren Verkaufspreis punkten und verfügte auch über eine zehnmal größere Anzahl an Spielen. Sega war bei Jugendlichen und älteren Spielern deutlich beliebter; dank der Marketingkampagne des Unternehmens kam es sogar vor, dass Besitzer eines Super NES sich schämten zuzugeben, dass sie eine Konsole von Nintendo besaßen.
Im Sommer 1990 wechselte der Vorsitz von Sega of America zu Tom Kalinske, der vier entscheidende Veränderungen einführte: eine drastische Preissenkung der Konsole, die Gründung einer amerikanischen Softwareabteilung, aggressive Marketingkampagnen und den Austausch des mitgelieferten Spiels. Statt "Altered Beast" wurde "Sonic the Hedgehog" zum neuen Aushängeschild. Kalinske setzte auf die Neuentwicklung von Sonic, die seit April 1990 in Arbeit war und das neue Maskottchen des Unternehmens darstellte. Sonic wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele des Unternehmens und steigerte den Umsatz enorm. Etliche Computerspielmagazine lobten das Spiel als bestes Plattformspiel aller Zeiten. Personen, die auf den Nachfolger des NES warteten, konnten überzeugt werden, stattdessen ein Mega Drive zu kaufen. Sega konnte nun den zweiten Platz in Amerika übernehmen und drängte die PC Engine auf den absteigenden Ast. 1992 besaß Sega 55 % des nordamerikanischen Marktes, während Nintendo mit dem Super NES lediglich 45 % verbuchen konnte. Zudem konnte Sega mit einem günstigeren Verkaufspreis punkten und verfügte auch über eine zehnmal größere Anzahl an Spielen. Sega war bei Jugendlichen und älteren Spielern deutlich beliebter; dank der Marketingkampagne des Unternehmens kam es sogar vor, dass Besitzer eines Super NES sich schämten zuzugeben, dass sie eine Konsole von Nintendo besaßen.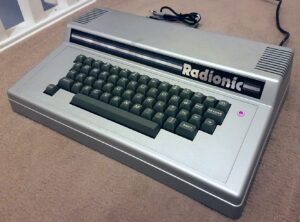
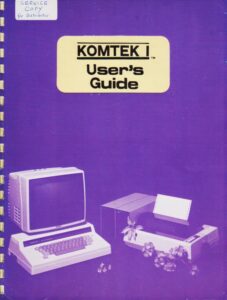 Der Komtek I war ein deutscher Heimcomputer, der als Nachbau des TRS-80 Model I von Tandy entwickelt wurde. Er wurde von Komtek Technologies hergestellt und bot eine kostengünstige Alternative zum Original. Der TRS-80 Model I, der 1977 auf den Markt kam, war einer der ersten weit verbreiteten Personal Computer und erfreute sich großer Beliebtheit bei Computerenthusiasten.
Der Komtek I war ein deutscher Heimcomputer, der als Nachbau des TRS-80 Model I von Tandy entwickelt wurde. Er wurde von Komtek Technologies hergestellt und bot eine kostengünstige Alternative zum Original. Der TRS-80 Model I, der 1977 auf den Markt kam, war einer der ersten weit verbreiteten Personal Computer und erfreute sich großer Beliebtheit bei Computerenthusiasten.
 1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.
1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.