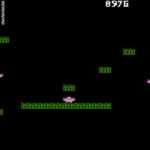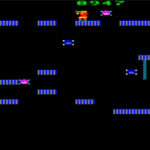Hercules (1984): Als ein Mann die Götter in 8 Bit herausforderte
 Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“
Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“
Die technische Basis war solide – ein klassisches Plattformgerüst mit seitlich scrollenden Bildschirmen, programmiert auf dem Commodore 64 in reinem Assembler, wobei Bak einen Großteil des Codes in Nachtschichten fertigstellte, während seine Frau die Sprites testete. Hercules sprang, kletterte, schwang sich an Seilen über Abgründe, wich Spinnen aus und suchte zwischen Eiskegeln, Vögeln und fliegenden Feuern nach den Symbolen der Götter. Das Spiel besaß über fünfzig Bildschirme, von denen immer zwölf zufällig für die jeweiligen „Labours“ ausgewählt wurden – eine frühe Form des Zufalls-Zugriffs-Prinzips, das Bak intern RAP nannte. In einem Interview sagte er: „Ich wollte, dass jedes Spiel ein wenig anders abläuft, so wie die Griechen nie wussten, welcher Gott ihnen gerade im Weg steht.“
Gerade dieses RAP-System machte das Spiel so eigenwillig. In der Rezension der ZZap!64 vom September 1986 schwärmte man von der Originalität des Zufallssystems: „The random accessing of tasks is a neat idea.“ Gleichzeitig nannte man die Grafik „abysmal“ („miserabel“) und den Sound „even worse“ („noch schlimmer“), aber die Spielmechanik „addictive and brilliant“ („süchtig machend und brillant“). Die Wertungen waren entsprechend bizarr verteilt: Präsentation 79 %, Grafik 21 %, Sound 20 %, Spielbarkeit 76 %, Langzeitmotivation 94 % und ein Gesamturteil von 92 %. Der Rezensent schloss mit einem Satz, der typisch britischen Humor atmete: „Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband – unter der schrecklichen Fassade steckt ein hervorragendes Plattformspiel.“
Tatsächlich war das Äußere spröde. Die C64-Grafik bestand aus pastellfarbenen Plattformen auf grünem Hintergrund, die Sprites erinnerten an frühe PET-Spiele, und die Animationen hatten einen Charme, der nur im britischen Budgetmarkt jener Jahre überlebensfähig war. Der Titelbildschirm bestand aus blinkenden Buchstaben, die ein Kritiker spöttisch als „naff title screen“ („mickriger Titelbildschirm“) bezeichnete. Doch im Inneren steckte ein Spiel, das eine merkwürdige Art von Tiefgang bot – unbarmherzig, aber lernbar, und mit jedem Tod wuchs der Wille, es noch einmal zu versuchen.
Hercules selbst, eine kleine, zuckende Figur mit schwarzen Umrissen, war alles andere als heroisch. Schon beim ersten Sprung merkte man, dass Bak eher an „Trial and Error“ als an Präzision geglaubt hatte. Jeder Bildschirm forderte millimetergenaue Sprünge, Seilakrobatik und das Vermeiden willkürlich auftauchender Feuerkugeln. Die britische Presse sprach süffisant von „einem Spiel für alle Plattform-Süchtigen – definitiv ein Spielkiller“, während die deutsche ASM im September 1986 deutlich formulierte: „...das Spiel – ein typisches Gerüst-Abenteuer – ist zwar von der Grafik eher als besch... zu bezeichnen, bietet aber in der 'Spielanlage' bemerkenswerte Spielfreuden!“ (Motivation: 10 Punkte). Ein Satz, der heute fast liebevoll klingt – und doch exakt den Reiz beschreibt, den viele empfanden: technisch rau, spielerisch belohnend.
Die Entwicklung verlief nicht ohne Rückschläge. Ursprünglich sollte es für jede der zwölf Aufgaben – vom Kampf mit der Hydra bis zum Einfangen des Kerynitischen Hirsches – eigene Grafiken und Gegner geben. Doch als Bak und das kleine Team bei Alpha Omega merkten, dass der Speicher des C64 dafür nicht ausreichen würde, reduzierte man auf etwa 50 Räume, von denen mehrere mehrfach genutzt wurden. Einige frühe Skizzen zeigten farbige Boss-Kreaturen, darunter einen geflügelten Stier, der nie über die Konzeptphase hinauskam. Auch eine Musikuntermalung war vorgesehen, doch der Speicherverbrauch des RAP-Systems ließ nur kurze Effektsequenzen zu.
Als CRL Group 1986 die Rechte übernahm und das Spiel erneut veröffentlichte, wurde die Präsentation leicht überarbeitet, aber die Technik blieb identisch. Nur das Cover wechselte – nun zierte ein muskelbepackter Held in Sandalen die Kassette, eine ironische Überhöhung der spartanischen Grafik im Spiel selbst. Die Spectrum-Version, portiert von Jim Bagley, lief flüssiger, aber litt unter Farbüberlagerung („Colour Clash“), während die Amstrad CPC-Version optisch sauberer war, dafür aber an Steuerverzögerung kränkelte. Die BBC Micro-Fassung von 1985, weitgehend identisch mit dem Original, lief intern unter einem leicht modifizierten BASIC-Interpreter. Auf dem C64 war der Code jedoch purer Assembler – und das merkte man an der Geschwindigkeit.
Marktwirtschaftlich war Hercules ein kleiner Erfolg. Bei einem Preis von 1,99 Pfund in der Budgetreihe von Alpha Omega verkaufte sich das Spiel in Großbritannien und Skandinavien zusammen schätzungsweise 35 000 Exemplare – beachtlich für ein Ein-Mann-Projekt. In Deutschland erschien es 1986 über T.S. Datensysteme zum Preis von 15 Mark, was inflationsbereinigt etwa 19 Euro entspräche. Die ASM bezeichnete es treffend als „kleines Wahrzeichen der britischen Budgetkultur“ – ein Spiel, das trotz oder gerade wegen seiner Schwächen eine Nische fand.
Steve Bak, geboren 1953 in Sheffield, hatte vor Hercules bereits an Bug-Byte’s Pipeline gearbeitet und sollte später zu einem der bekanntesten C64-Programmierer der mittleren Achtziger werden. Nach Hercules wechselte er zu Mikro-Gen und programmierte das exzellente Starstrike II, bevor er durch seine Amiga-Arbeiten (Return to Genesis, Goldrunner, Leatherneck) endgültig Legendenstatus erlangte. In Interviews erinnerte er sich mit gemischten Gefühlen an Hercules: „Es war meine erste Solo-Veröffentlichung – ein bisschen verrückt, ein bisschen kaputt, aber die Leute liebten genau diese Verrücktheit.“ Der Komponist Ben Daglish, der einige Effekte beisteuerte, nannte das Projekt rückblickend „ein charmantes Durcheinander – sehr britisch, sehr Steve.“
Trivia gibt es reichlich. So hieß der Prototyp intern „Zeus’s Son“ und hatte statt Plattformen bewegliche Wolken. Ein Level war als vertikaler Aufstieg in den Olymp geplant, fiel aber der Ladezeit zum Opfer. Der ursprüngliche Plan, jede der zwölf Aufgaben mit Texttafeln einzuleiten, wurde gestrichen, um Speicher zu sparen – Bak erzählte später lachend, dass er diese Texte im Handbuch wiederverwertete. Sogar das Kassetten-Inlay hatte eine Eigenheit: Die deutsche Version druckte versehentlich „Hercules 1985“ statt 1984, wodurch das Spiel in manchen Datenbanken falsch datiert ist.
Obwohl die Kritiker über die Technik spotteten, fanden viele Spieler das Konzept faszinierend. Der ZZap!64-Redakteur Gary Penn schrieb: „Glaub es oder nicht, Hercules ist ein großartiges Spiel. Die Action ist schnell und intensiv – ich würde es heiraten.“ Die Mischung aus Humor und Frustration, aus Heldentum und Hilflosigkeit, war typisch britisch und machte das Spiel zu einem Kulttitel. Selbst Jahrzehnte später taucht Hercules regelmäßig in Retro-Foren auf, wo Veteranen gestehen, dass sie es nie ganz geschafft haben, alle zwölf Aufgaben zu meistern.
Im Rückblick ist Hercules eines jener Spiele, das den Geist der frühen Achtziger perfekt einfängt: ein Mann, ein Computer, ein übergroßer Traum – und ein Resultat, das trotz technischer Grenzen Herz und Witz hat. Es war weder schön noch perfekt, aber unvergesslich. Oder wie es die Alpha Omega-Rezension schon 1984 mit typisch britischem Understatement zusammenfasste: „Hercules beweist, dass Plattformspiele so alt sind wie die Griechen selbst.“ Und wer einmal den ersten Sprung über den Abgrund nicht schaffte, wusste: Selbst Halbgötter fallen manchmal tief – besonders auf dem C64.