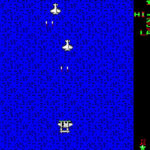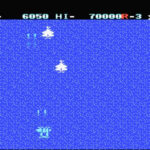1942 – Der Münzschlucker, der Geschichte schrieb
 Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog Z80 Prozessor auf rund 4 MHz und einem Soundchip von Yamaha auskam – technisch kein Meilenstein, aber die Spielmechanik und das Tempo machten den Unterschied.
Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog Z80 Prozessor auf rund 4 MHz und einem Soundchip von Yamaha auskam – technisch kein Meilenstein, aber die Spielmechanik und das Tempo machten den Unterschied.
Das Spielprinzip war so simpel wie süchtig machend: Der Spieler steuerte ein Lockheed P-38 Lightning, im Spiel „Super Ace“ genannt, und musste sich durch Wellen feindlicher Flugzeuge, Bomber und Bossformationen kämpfen. Markant war die Möglichkeit, mit einer Fassrolle kurzzeitig gegnerischem Feuer zu entgehen – ein Kniff, der sich tief ins Gedächtnis der Spieler eingebrannt hat.
Die Entstehungsgeschichte ist geprägt von pragmatischen Entscheidungen. Erste Skizzen zeigten noch ein reines Science-Fiction-Szenario mit Raumschiffen, da das Team nach dem Erfolg von Xevious zunächst in dieselbe Kerbe schlagen wollte. Doch Okamoto verwarf die Idee und bestand auf einer „bodenständigeren“ Umsetzung. Ein verworfenes Level spielte auf einem Flugzeugträgerdeck, das in Echtzeit durch Bombentreffer zerlegt werden sollte – eine Idee, die aufgrund von Speicher- und Prozessorgrenzen wieder gestrichen wurde. Auch ein Koop-Modus für zwei Spieler gleichzeitig war in frühen Tests enthalten, kam aber nie ins finale Programm, weil die Performance auf dem Arcade-Board stark einbrach.
Wirtschaftlich war 1942 ein voller Erfolg. Die Arcade-Platinen verkauften sich über 25.000 Mal weltweit – eine beeindruckende Zahl für ein japanisches Studio, das damals noch nicht die Größe von Namco oder Sega hatte. In Großbritannien kostete ein Automat in den Spielhallenbetreiber-Katalogen rund 1.200 Pfund Sterling (heute inflationsbereinigt etwa 4.300 Euro), während Heimversionen für Heimcomputer je nach Medium zwischen 7,95 Pfund (Kassette, ca. 30 Euro) und 12,95 Pfund (Diskette, ca. 48 Euro) kosteten. Später wurden Budget-Versionen bei Labels wie Kixx und Encore für 2,99 Pfund (heute etwa 9 Euro) neu aufgelegt, was den Titel noch Jahre nach der Erstveröffentlichung in den Charts hielt.
Die Portierungen sorgten für Diskussionen, da die technischen Unterschiede unübersehbar waren. Auf dem Commodore 64 glänzte 1942 durch flüssige Scrolling-Routinen, doch die Grafik wirkte grob und die Musik blieb hinter den Arcade-Klängen zurück. In der ASM 11/86 hieß es nüchtern: „Die Grafik ist zu eintönig, der Sound wenig abwechslungsreich“ – Ergebnis waren 7 von 12 Punkten. Die Spectrum-Version hingegen war grafisch stark reduziert, bot aber eine erstaunlich schnelle Darstellung der Sprites, die das Fehlen von Farben beinahe vergessen ließ. Die Amstrad-CPC-Fassung punktete mit bunteren Hintergründen, allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit. Auf dem NES, das Capcom selbst in den USA veröffentlichte, bekam das Spiel eine ganz eigene Handschrift: die Steuerung war präzise, der Sound knackiger und die Gegnerformationen leicht abgewandelt, sodass viele Spieler die NES-Version bis heute als eigenständige Interpretation sehen.
In der Happy Computer Power-Play-Sonderausgabe 1/87 erhielt die C64-Version 63 %. Dort hieß es: „1942 hat durchaus einen gewissen Spielreiz. Obwohl das Programm auf den ersten Blick einfach aussieht, kann es eine Weile am Joystick fesseln. Die Abwechslung hält sich jedoch in Grenzen … Ein nettes Liedchen und die übliche Taka-Takka-Pang-Sprotzl-Geräuschkulisse während des Spiels.“ Die Grafik wurde mit 40 %, Sound & Musik mit 61 % bewertet – insgesamt ein solides, aber keineswegs herausragendes Urteil.
Kritik gab es auch in Japan, wo die Darstellung des Zweiten Weltkriegs aus westlicher Sicht nicht unumstritten war. In manchen Kommentaren wurde gar von „Geschichtsverfälschung“ gesprochen. Capcom verteidigte sich mit dem Hinweis, man wolle keine politischen Botschaften transportieren, sondern schlicht ein spannendes Actionspiel bieten. Trotzdem blieb der Beigeschmack, dass ein japanisches Studio einen Titel entwickelte, in dem die eigenen Landsleute die Gegner waren.
Die Entwickler trugen 1942 weit über den Titel hinaus. Yoshiki Okamoto zeichnete später verantwortlich für Klassiker wie Final Fight und Street Fighter II. Noritaka Funamizu wirkte an Forgotten Worlds und Final Fight One mit, während Akira Nishitani mit Street Fighter II Turbo und Street Fighter Alpha in die Spielegeschichte einging. Der Komponist Tamayo Kawamoto, damals eine der wenigen Frauen im japanischen Sounddesign, lieferte einen minimalistischen, aber eingängigen Soundtrack, der in späteren Jahren als frühes Beispiel für Capcoms musikalische Handschrift gilt.
Trivia gibt es reichlich: Die Bezeichnung 1942 wurde bewusst gewählt, weil 1941 in Japan als Unglückszahl gilt – daher entschied man sich für das Folgejahr. Die P-38 Lightning war nicht nur ikonisch, sondern auch ein persönlicher Favorit Okamotos, der als Kind Modellbausätze dieser Maschine baute. Und nicht zuletzt war 1942 eines der ersten Capcom-Spiele, das in Europa stärker lief als im Heimatmarkt Japan – eine Seltenheit, die Capcoms Strategie, sich global auszurichten, nachhaltig beeinflusste.
Die Nachfolger ließen nicht lange auf sich warten: 1943: The Battle of Midway bot Koop-Modus und mächtigere Grafik, 1941: Counter Attack brachte das Franchise auf Capcoms CPS-Board mit satten Farben und Stereo-Sound, während 19XX: The War Against Destiny Mitte der 1990er Jahre die Serie in die moderne Arcade-Ära katapultierte. Auch Konsolen wie das Super Nintendo und die PlayStation erhielten Umsetzungen oder Sammlungen, sodass die Reihe bis heute in Retro-Compilations lebt.
Unterm Strich ist 1942 ein Paradebeispiel für Capcoms frühe Philosophie: klare Mechanik, einprägsame Ästhetik und ein Gameplay, das bis heute funktioniert. Oder wie die Power Play 1/87 es auf den Punkt brachte: „1942 hat durchaus einen gewissen Spielreiz“, auch wenn die technischen Abstriche der Heimcomputerfassungen unübersehbar waren.