Vector 4
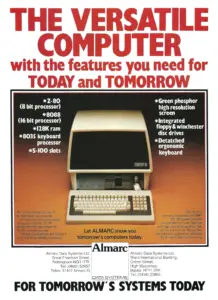
Picture ist taken from: https://nosher.net/archives/computers/personal_comp_world_1982-07_001?idx=Vector
Im Frühjahr 1982 brachte das kalifornische Unternehmen Vector Graphic Inc. mit dem Vector 4 einen bemerkenswert ambitionierten Desktop-Computer auf den Markt, der sich gleichermaßen an Unternehmen und ambitionierte Einzelanwender richtete. Technisch betrachtet handelte es sich um einen hybriden Rechner, der sowohl den Zilog Z80A mit 4 MHz als auch den Intel 8088 Prozessor integrierte – letzterer auch das Herzstück des kurz zuvor erschienenen IBM PC. Diese doppelte Prozessorarchitektur sollte es ermöglichen, sowohl das bewährte CP/M-Betriebssystem als auch MS-DOS auszuführen – ein Alleinstellungsmerkmal, das in Branchenkreisen Aufsehen erregte. Die Verantwortlichen bei Vector Graphic bezeichneten den Vector 4 in einem Interview mit der Zeitschrift Personal Computer World als „a bridge between two generations of software platforms“ (eine Brücke zwischen zwei Softwaregenerationen).
Der Vector 4 war in einem rechteckigen Metallgehäuse untergebracht, das etwa 45 cm breit, 40 cm tief und 20 cm hoch war. Das Gewicht lag bei rund 12 kg. Intern basierte die Architektur auf dem S-100-Bus, einem offenen Industriestandard, der dem Anwender eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten bot. Bereits in der Grundausstattung verfügte der Rechner über 64 KB RAM für den Z80-Strang, konnte aber über Steckkarten erweitert werden. Das Display war monochrom, bei einer grafischen Auflösung von schätzungsweise 640×480 – eine für die damalige Zeit ordentliche Leistung, wenngleich keine Farbdarstellung möglich war. Eine geplante Farbgrafikkarte wurde zwar konzipiert, aber nie zur Serienreife gebracht. Soundseitig war das System mit einem einfachen internen Piezo-Speaker ausgestattet, ein Soundchip wie der AY-3-8912 oder gar ein SID war nicht vorgesehen.
Als Massenspeicher dienten zwei 5¼-Zoll-Diskettenlaufwerke mit 96 TPI, später wurden Modelle mit einem zusätzlichen 8-Zoll-Laufwerk oder sogar einer 10-Megabyte-Festplatte von Shugart angeboten. Laut dem Computer Business Review sollten auch Tape-Backup-Lösungen sowie ein eigenes Streaming-Bandlaufwerk folgen, die jedoch in der Entwicklung blieben. Geplante Peripheriegeräte umfassten Drucker, eine Farbgrafik-Workstation und ein eigenständiges RAM-Disk-Modul. Letzteres erschien 1983 in Kleinserie. Die Schnittstellen umfassten serielle und parallele Anschlüsse, sowie einen S-100-Erweiterungsport.
Der Preis des Vector 4 betrug bei Markteinführung rund 3.495 US-Dollar – inflationsbereinigt entspricht das etwa 10.800 Euro im Jahr 2025. Damit war er günstiger als viele Großrechnersysteme, aber deutlich teurer als der IBM PC in Grundkonfiguration. Die Unternehmensgründer Robert Harp und seine Frau Lore Harp McGovern hatten Vector Graphic bereits 1976 gegründet. Lore Harp war eine der ersten Frauen, die ein börsennotiertes Computerunternehmen leitete. In einem Interview mit dem BYTE Magazine von 1983 sagte sie: „We didn’t want to copy the IBM PC – we wanted to do something smarter“ (Wir wollten den IBM PC nicht kopieren – wir wollten etwas Klügeres machen). Während Robert Harp primär für die technische Entwicklung verantwortlich war, übernahm Lore Harp den geschäftlichen Bereich und brachte Vector Graphic 1981 an die Börse.
Das Betriebssystem war wahlweise CP/M 2.2, MS-DOS 1.25 oder ein hauseigenes System namens FlashWriter II, das insbesondere für Textverarbeitung ausgelegt war. Es konnte direkt aus dem ROM gebootet werden, wodurch der Rechner binnen Sekunden einsatzbereit war – eine Seltenheit in der damaligen Zeit. FlashWriter wurde mit einer Wordprocessor-Software ausgeliefert, die laut der Zeitschrift InfoWorld „the most efficient standalone text editing environment under $5000“ (die effizienteste Textverarbeitungsumgebung unter 5000 Dollar) war.

Auch in der Serie A-Team konnte der Vicro bewundert werden
Eine interessante Anekdote aus der Frühzeit des Vector 4 betrifft seine Ankündigung auf der West Coast Computer Faire 1982: Während viele Besucher auf den Apple III oder IBM PC starrten, präsentierte Vector Graphic seinen neuen Rechner in einem komplett abgeschlossenen Raum, zugänglich nur für Vorabkunden und Investoren. Diese Geheimhaltung sorgte in der Branche für Spekulationen. PC World schrieb später süffisant: „Vector Graphic may have launched a great machine – but they cloaked it like the CIA.“ (Vector Graphic hat vielleicht eine großartige Maschine vorgestellt – aber sie haben sie getarnt wie der Geheimdienst.)
Verkauft wurden vom Vector 4 nach eigenen Angaben rund 13.000 Einheiten weltweit. Davon entfielen etwa 8.000 auf den US-Markt, der Rest ging nach Kanada, Europa und Australien. Während der Vector 4 in Fachkreisen gelobt wurde – insbesondere für seine Betriebssystemsvielfalt und Erweiterbarkeit –, konnte er sich auf dem zunehmend von IBM-kompatiblen Rechnern dominierten Markt nicht behaupten. Die New York Times schrieb 1984: „Vector Graphic built a bridge – but the world already crossed the IBM highway“ (Vector Graphic baute eine Brücke – aber die Welt fuhr bereits auf der IBM-Autobahn). Die Verkaufszahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück, und als die Börsenbewertung des Unternehmens 1984 einbrach, trat Lore Harp zurück. 1985 musste Vector Graphic Konkurs anmelden.
In der Rückschau bleibt der Vector 4 ein faszinierendes Relikt einer Übergangszeit: Ein Rechner, der technisch viel versprach und mit mutigen Entscheidungen wie der Dual-Prozessor-Architektur neue Wege ging. Doch genau diese Vielschichtigkeit wurde ihm auch zum Verhängnis – IBM hatte den Markt längst standardisiert, und kostengünstigere Kompatible überfluteten die Branche. Der Vector 4 war damit das letzte ernstzunehmende System aus dem Hause Vector Graphic, ein Schwanengesang auf den S-100-Bus und auf eine Ära, in der visionäre Kleinunternehmen noch mit Big Playern konkurrieren konnten. Wer heute einen Vector 4 mit funktionierenden Diskettenlaufwerken findet, besitzt ein rares Stück Rechenhistorie – und ein Mahnmal dafür, wie nahe Genie und Untergang im Computerzeitalter beieinanderliegen können.
